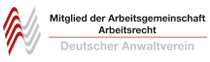Neues Urteil zur Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes (§ 23 I 4 KSchG) / Darlegungslast für Kleinbetrieb
Am 28.04.2016 hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eine sehr interessante Entscheidung getroffen, nach der es für viele Arbeitnehmer leichter werden dürfte, in den Schutzbereich des Kündigungsschutzgesetzes zu gelangen.
Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz
Die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes ist in § 23 KSchG geregelt. Grundsätzlich gilt, dass der jeweilige Arbeitnehmer mindestens 6 Monate im Betrieb beschäftigt sein muss und der Betrieb mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt (für sogenannte Altarbeitnehmer können mehr als 5 reichen), damit das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Insofern werden Teilzeitbeschäftigte je nach ihrer wöchentlichen Arbeitszeit zahlenmäßig allerdings nur mit dem Faktor 0,5, bzw. 0,75 als Arbeitnehmer des Betriebes erfasst.
Falls also streitig ist, wie viele Leute – wie viele Stunden pro Woche – im Betrieb arbeiten, stellt sich die Frage, wer dies denn beweisen muss. Denn hiervon kann häufig abhängen, wie der Prozess ausgeht, wenn der Beweis anschließend nicht erbracht werden kann.
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zur Darlegungs- und Beweislast
Das Bundesarbeitsgericht hat insofern bereits mit Urteil vom 26.06.2008 (2 AZR 264/07) entschieden, dass die Beweislast hinsichtlich der Anzahl der Beschäftigten grundsätzlich den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin trifft und dass im Fall der Unergiebigkeit der vom Gericht erhobenen Beweise, wenn also weder fest steht, dass es mehr als 10 Arbeitnehmer sind, noch, dass es nicht mehr als 10 sind, weil man es einfach nicht genau klären konnte, dieses sogenannte „non liquet“ zu Lasten der Arbeitnehmer geht. Das Gericht geht in diesem Fall also (weil der Arbeitnehmer nicht beweisen konnte, dass es mehr als 10 Arbeitnehmer sind) von einem Kleinbetrieb aus, so dass das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist und der Arbeitgeber recht einfach kündigen kann.
Generell gelten im Arbeitsgerichtsprozess die Grundsätze der abgestuften Darlegungs- und Beweislast. Der Arbeitnehmer genügt daher regelmäßig seiner Darlegungslast zunächst durch die bloße Behauptung, der Arbeitgeber beschäftige regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer. Sodann muss der Arbeitgeber sich über die Anzahl der Beschäftigten vollständig erklären und auch die ihm zur Verfügung stehenden Beweismittel benennen. Hierzu muss dann wiederum der Arbeitnehmer Stellung nehmen sowie den Beweis antreten. Erst wenn dies nicht gelingt, geht das non-liquet zu seinen Lasten.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes trifft die Beweislast für die nötige Anzahl der Arbeitnehmer also letzten Endes den Arbeitnehmer.
Neues Urteil des Landesarbeitsgerichtes Berlin-Brandenburg
Im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen einem Arbeitnehmer, der seit 2011 als Vertriebsleiter für die Beklagte, eine Fondsgesellschaft, arbeitete und eben dieser Beklagten hatte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zu entscheiden, ob das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) bei der Kündigung des Klägers durch die Beklagte zur Anwendung zu gelangen hatte; denn hiervon hing maßgeblich die Wirksamkeit der hilfsweise ausgesprochenen ordentlichen Kündigung ab. Es kam dabei nicht entscheidend auf die reine Anzahl der Arbeitnehmer (diese war unstreitig), sondern vor allem auf die von diesen geleistete Arbeitszeit an.
Im zu entscheidenden Fall beschäftigte die Beklagte zum Zeitpunkt der bzgl. ihrer Wirksamkeit streitigen Kündigung neben dem Kläger weitere acht Arbeitnehmer in Vollzeit, sowie einen mit neun Wochenstunden geringfügig beschäftigten Mitarbeiter an ihrem Betriebsstandort in München. Am Betriebsstandort in Hamburg war zudem eine weitere Mitarbeiterin als Senior-Fondsmanagerin beschäftigt, deren wöchentliche Arbeitsstundenzahl zwischen den Parteien streitig war. Außerdem war für die beiden Betriebsstandorte jeweils ein Geschäftsführer tätig.
Nach Maßgabe von § 23 KSchG war durch das Landesarbeitsgericht zunächst zu beurteilen, ob es sich – wie durch die Beklagte vorgebracht – bei den Betriebsstandorten München und Hamburg um zwei voneinander getrennt zu betrachtende Betriebe handelte. Dies verneinte das Landesarbeitsgericht. Als Maßstab legte es hierfür den arbeitsrechtlichen Betriebsbegriff des Bundesarbeitsgerichts an, nach welchen unter einem Betrieb eine organisatorische Einheit zu verstehen sei, innerhalb derer mit Hilfe von sächlichen und immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt würden, die sich nicht in der Befriedigung von Eigenbedarf erschöpfen. Zwar besäßen beide Betriebsstandorte eine gewisse Selbstständigkeit, nähmen aber jeweils nur eine Teilfunktion des arbeitstechnischen Zwecks des Gesamtbetriebes wahr. Dementsprechend war die Hamburger Mitarbeiterin der Anzahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer hinzuzurechnen.
Darlegungs- und Beweislast für geringen Arbeitsumfang liegt beim Arbeitgeber
Hinsichtlich des sodann zu klärenden, wöchentlichen Stundenumfangs der Beschäftigung der Hamburger Mitarbeiterin brachte der Kläger vor, dass der tatsächliche Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit dieser Mitarbeiterin den eines herkömmlichen Vollarbeitsverhältnisses habe.
Hier führte das Landesarbeitsgericht aus, dass zwar im Arbeitsvertrag zunächst nur 15 Wochenstunden vereinbart worden waren, welche später durch Nachtrag auf 18 Wochenstunden aufgestockt worden waren, diese Zahl aufgrund der umfassenden Aufgabenbereiche der Mitarbeiterin wohl aber zu gering angesetzt sei. Jedoch könne die Anzahl der durch die Hamburger Mitarbeiterin tatsächlich abgeleisteten wöchentlichen Arbeitsstunden hier dahinstehen – schließlich liege die Darlegungs- und Beweislast für die Ausnahmevorschrift des § 23 I 2, 4 KSchG bei der Beklagten als Arbeitgeberin.
Dies folge schon aus dem sprachlichen Aufbau von § 23 KSchG. Grundsätzlich gelte hiernach der Kündigungsschutz, und nur in Ausnahmefällen, nämlich bei Unterschreitung des Schwellenwertes, also bei Kleinbetrieben sei dem nicht so. Ferner verdeutliche die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Nichtanwendbarkeit des KSchG bei allen Kleinbetrieben auf die Fälle zu beschränken sei, in denen die Benachteiligung der betroffenen Arbeitnehmer sachlich begründet sei, den Ausnahmecharakter der Regelung. Größere Unternehmen, die lediglich über eine Vielzahl von Kleinbetrieben verfügen, sind demnach vom Kündigungsschutz nicht auszunehmen. Für die Beweislastverteilung zu Ungunsten des Arbeitgebers spreche ferner der sogenannte „Sphärengedanke“: Aufgrund der Sachnähe des Arbeitgebers zu den betrieblichen Strukturen, inklusive der jeweiligen Arbeitszeiten der einzelnen Arbeitnehmer, sei ihm die Beweiserbringung hier möglich, während diesbezüglich von einem Arbeitnehmer keine Detailkenntnisse erwartet werden können.
Da die Beklagte hier keinen dahingehenden Beweis erbracht hatte, dass die wöchentlichen Arbeitsstunden tatsächlich so gering ausfielen, dass das Kündigungsschutzgesetz in Ermangelung von mehr als zehn Arbeitnehmern hier nicht zur Anwendung gelangen könne, wendete das Landesarbeitsgericht das Kündigungsschutzgesetz an und erklärte die ausgesprochenen Kündigungen für unwirksam.
Fazit
Es liegt also nach dem Urteil des Landesarbeitsgerichtes nicht in der Verantwortung eines gekündigten Arbeitnehmers, die Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeit einer Kollegin/eines Kollegen zu beweisen, um durch die hierdurch erfolgende Überschreitung des Schwellenwertes sodann Kündigungsschutz für sich geltend machen zu können. Vielmehr liege die Darlegungs- und Beweislast insofern beim Arbeitgeber. Kann er den Beweis nicht erbringen und geht das Gericht im Sinne des Arbeitnehmers von einer Überschreitung aus, so besteht für den gekündigten Arbeitnehmer Kündigungsschutz.
Dies widerspricht der bisherigen Annahme gemäß Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, der Arbeitnehmer habe zu beweisen, dass der Schwellenwert überschritten wird, zumindest in Teilen. Ob sich andere Landesarbeitsgerichte und das Bundesarbeitsgericht dieser Rechtsprechung anschließen, bleibt abzuwarten.
Denkbar wäre natürlich auch, dass zukünftig unterschieden wird in Bezug auf die reine Anzahl der Beschäftigten (Beweislast wie bisher gemäß Urteil des Bundesarbeitsgerichtes beim Arbeitnehmer) und die Anzahl der von diesen jeweils geleisteten Stunden (Beweislast entsprechend dem vorgenannten Urteil des Landesarbeitsgerichtes beim Arbeitgeber). Dies erscheint auch sachgerecht, da der Arbeitgeber insofern einen immensen Wissensvorsprung hat, was die Anzahl der geleisteten Stunden angeht.
Quelle: Urteil des LArbG Berlin-Brandenburg v. 28.04.2016, 10 Sa 887/15 10 Sa 2231/15, 10 Sa 887/15, 10 Sa 2231/1